Rahmenprogramm empirische BildungsforschungNachwuchsforschungsgruppen
Warum wissenschaftlichen Nachwuchs fördern?
Ganz konkret bedeutet das, anwendungsorientierte und empirische Forschung zu fördern, die von Anfang an die Anwendbarkeit der Ergebnisse in der Praxis mitdenkt und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Bildungspraxis stärkt.
Wer wird gefördert?
Die Themen reichen von der Digitalisierung und gesellschaftlichen Vielfalt über die Qualität der Lehramtsausbildung bis hin zur Sensibilisierung vor sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten.
Educational Integration of Refugee Children and Youth in GermanyEDIREGBildungsintegration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund in Deutschland
- Zwischen 2014 und 2018 kamen über eine Million Geflüchtete nach Deutschland.
- Die Hälfte sind im schul- und ausbildungsfähigen Alter.
- Geflüchtete Heranwachsende befinden sich in einer besonderen Bildungssituation.
- Übergänge von einer Bildungseinrichtung zur nächsten
- Bildungsbeteiligung (z.B. am Gymnasium)
- Erwerb schulischer Fähigkeiten (z.B. Lesen und Mathematik)
- Aufnahme
einer Berufsausbildung
Formatives Assessment beim Schreiben FORMATAutomatisiertes Feedback unter Verwendung von künstlicher Intelligenz
Da individuelles Feedback einer der wirksamsten Faktoren zur Förderung dieser Kompetenzen ist, verfolgen die Mitglieder der Nachwuchsforschungsgruppe FORMAT das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu KI-basiertem Feedback bereitzustellen und mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) die Schreibkompetenzen von Schülerinnen und Schülern in Deutsch und Englisch zu verbessern.
Forschungsfragen und Methoden
Multiliteralität als ArbeitsmarktressourceMARESoziale Erwerbsbedingungen multiliteraler Kompetenzen und deren Nutzen als ökonomisches Kapital
Der ökonomische Wandel und die Digitalisierung verändern auch die Nachfrage von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt, sodass Mehrsprachigkeit und schriftsprachliche Fähigkeiten immer wichtiger werden.
MARE erforscht daher, wie sich diese sogenannte Multiliteralität im Jugendalter entwickelt und unter welchen Bedingungen sie die Chancen für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt erhöht.
Forschungsfragen und Methoden
Wie hat Ihnen die Webreportage gefallen?
Hier gelangen Sie zu einer zweiminütigen Evaluation. Durch Ihre Teilnahme helfen Sie uns, unsere Webreportagen zu verbessern.
Forschungsfragen und Methoden
EDIREG Forschungsfragen und Methoden
Das Umfeld kann den Bildungserfolg entweder erleichtern oder sogar verhindern. Um dies zu analysieren, werten die Forschenden große Bevölkerungsumfragen und Daten aus repräsentativen Schulleistungsstudien und Flüchtlingsstudien aus.
Um die Kompetenzentwicklung und Bildungsbeteiligung geflüchteter Kinder und Jugendlicher in regionalen vergleichend zu untersuchen, nutzt das Projekt verschiedene Sekundärdatensätze.
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
FORMATForschungsfragen und Methoden
Dazu entwickeln die Forschenden ein KI-gestütztes Schreibtool und führen eine experimentelle Untersuchung durch, die prüft, wie wirksam KI-basiertes Feedback ist. Dabei berücksichtigen sie auch individuelle Merkmale der Lernenden, Feedback-Qualität und den Lernprozess.
Es werden zum Beispiel Textkorpora aus vorangegangenen Projekten zu Aufgaben aus der Sekundarstufe I und II genutzt und mit jeweils mehr als 1000 Texten sogenannte Machine Learning Algorithmen trainiert, auf deren Basis automatisiert Feedback gegeben werden kann.
Das Projekt zielt darauf ab, innovative Methoden und Tools für den Bildungsbereich zu entwickeln, die Lehrkräfte entlasten und die Bildungsgerechtigkeit fördern.
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
MARE Forschungsfragen und Methoden
MARE schafft Grundlagenwissen über diese Form von Mehrsprachigkeit und untersucht die Wirkung der Fähigkeiten als soziales Kapital auf dem Arbeitsmarkt.
Die Forschenden führen Sekundäranalysen bestehender large scale-Datensätze der Studien Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf und des Nationalen Bildungspanels durch.
Ein besonderes Merkmal von MARE ist der Fokus auf die empirische Untersuchung objektiver Testdaten zu analogem und digitalem Lesen und Schreiben in Deutsch (Mehrheitssprache), Russisch und Türkisch (Herkunftssprachen), Englisch und Französisch (Schulfremdsprachen).
Darüber hinaus wollen die Forschenden im Sinne des Wissenstransfers ein Testverfahren entwickeln, das solche sprachlichen Kompetenzen im Prozess der Arbeitsvermittlung erkennbar und nutzbar macht.
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
Ergebnisse und Praxisbeitrag
EDIREGErgebnisse und Beitrag für die Praxis?
- Startbedingungen: Geflüchtete Kinder und Jugendliche beginnen ihre Schulkarriere in Deutschland oft mit sprachlichen und fachlichen Nachteilen, die stark von der Aufenthaltsdauer und der vorherigen Bildung abhängen.
- Schulische Integration: Eine schnelle Aufnahme in Regelklassen und kontinuierliche Sprachförderung begünstigen den Lernerfolg besser als längere Phasen in separaten Willkommensklassen.
- Regionale und institutionelle Unterschiede: Bildungschancen junger Geflüchteter hängen von bundeslandspezifischen Schulstrukturen ab. Ungünstige lokale Marktlagen erschweren ihnen die Aufnahme einer Berufsbildung.
- Kompetenzen und langfristige Perspektiven: Auch mit längerer Zeit im deutschen Schulsystem haben junge Geflüchtete deutlich geringere Kompetenzen in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften. Nicht mehr schulpflichtigen jungen Geflüchteten helfen berufssprachliche Fördermaßnahmen, in eine Berufsausbildung überzugehen.
- Geflüchtete Frauen brauchen mehr Unterstützung: Ihre Chancen für die Aufnahme einer Berufsausbildung sind stark vermindert.
Zurück zum Projekt
FORMATErgebnisse und Beitrag für die Praxis
KI kann den Lernenden Feedback zu ihren schriftlichen Leistungen geben und so Lehrkräfte in der Beurteilung der Leistungen unterstützen und entlasten.
Somit sollen Bildungschancen gerechter gestaltet werden und Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bestmögliche Lerngelegenheiten geboten werden.
Zurück zum Projekt
MAREErgebnisse und Beitrag für die Praxis
- Das Systematic Review zeigt: mehrsprachige Pflegekräfte erzielen im internationalen Vergleich eher non-monetäre Erträge durch die Mehrsprachigkeit im Arbeitsalltag.
- Längsschnittliche Large-Scale-Testdaten zeigen: Mehrsprachige Schreibfähigkeit entwickelt sich über die gesamte Sekundarstufe und steht den Fähigkeiten im Deutschen nicht im Wege.
- Zwei Drittel der Befragten (18-65 Jahre) verfügen über eine ausgeprägte Literalität in Deutsch und ihrer Herkunftssprache. Höhere mehrsprachige Kompetenzen und Literalität begünstigen bessere Bildungs- und Berufsbildungsabschlüsse und erhöhen die Chancen, in Deutschland einen Arbeitsplatz zu haben.
Ziel des Projekts MARE ist es, der Bildungspraxis Grundlagenwissen zur Multiliteralität zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird ein Testverfahren entwickelt, das es Berufsvermittlungen und Anbietern von Weiterbildungen ermöglicht, multiliterale Kompetenzen schnell zu erkennen, um Arbeitnehmer entsprechend auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren.
Zurück zum Projekt

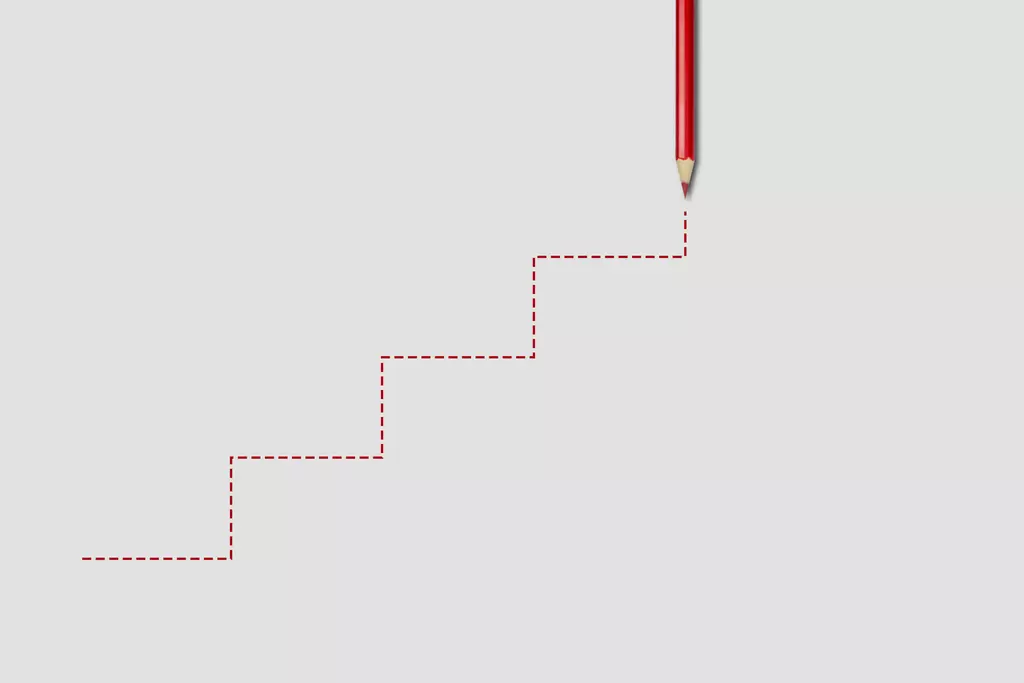
























 Nachwuchsforschungsgruppen
Nachwuchsforschungsgruppen
 Warum wissenschaftlichen Nachwuchs fördern?
Warum wissenschaftlichen Nachwuchs fördern?
 Wer wird gefördert?
Wer wird gefördert?
 Exemplarische Projekte aus den Nachwuchsforschungsgruppen
Exemplarische Projekte aus den Nachwuchsforschungsgruppen
 EDIREG
EDIREG
 FORMAT
FORMAT
 MARE
MARE
 Weitere Infos zu den Projekten
Weitere Infos zu den Projekten
 Wie hat Ihnen die Webreportage gefallen?
Wie hat Ihnen die Webreportage gefallen?
 Forschungsfragen und Methoden
Forschungsfragen und Methoden
 Forschungsfragen und Methoden
Forschungsfragen und Methoden
 Forschungsfragen und Methoden
Forschungsfragen und Methoden
 Ergebnisse und Beitrag für die Praxis?
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis?
 Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
 Ergebnisse und Beitrag für die Praxis
Ergebnisse und Beitrag für die Praxis